Social-Media-Strategie und das Verhältnis zu Journalisten ergeben in Krisen verschiedene Chancen und Risiken für PR-Praktiker.
Negativität ist eine Eigenschaft von Ereignissen, die Menschen interessant finden – somit ist sie auch für Journalisten interessant, denn immerhin wollen diese, dass ihre Artikel gelesen werden. Gerät ein Unternehmen nun in eine Krise, ist diese Eigenschaft der Negativität zu unterstellen. Für Unternehmenskommunikatoren wird die Lage brenzlig. Welche Chancen, aber auch welche Risiken ergeben sich nun aber in Krisensituationen für Kommunikatoren? Wovon hängt dies ab?
Diesen Fragen gingen die zwei Wissenschaftler Bengt Johansson und Tomas Odén von der Universität Göteborg in einer Studie nach. Sie befragten in persönlichen Interviews 26 schwedische PR-Praktiker, die in verschiedenen Krisenfällen für Behörden sowie Unternehmen in öffentlicher Hand kommuniziert haben. Die Wissenschaftler schreiben dazu, dass Kommunikatoren in diesem Bereich in Krisensituationen keine andere Wahl hätten, als zu reagieren. Hierzu ist zu sagen, dass private Unternehmen sich zwar auch dafür entscheiden können, keine Informationen weiterzugeben. Doch damit laufen sie Gefahr, ihre Reputation zu schädigen. Insofern sollten auch private Unternehmen während Krisen kommunizieren.
Journalisten: Freund oder Feind
Johansson und Odén stellten fest, dass sich die befragten Kommunikatoren in zwei Dimensionen unterschieden. Die erste Dimension ist ihre Sicht auf Journalisten: Sehen die Kommunikatoren diese als Helfer oder als Gegenspieler? Sowohl die vergangenen Erfahrungen als auch das Ausmaß der Krise beeinflussen diese Ausprägung. Laut der Wissenschaftler gilt bei letzterem: Je größer die Krise ist, desto stärker der Kampf um die Deutungshoheit bei den Ereignissen. Die klassischen Medien sind unter den Befragten aber nach wie vor wichtig für die Vermittlung von Informationen an die Bevölkerung in Krisenfällen.
Social Media: ja, nein, vielleicht?
Die zweite Dimension der Unterscheidung betreffe die Aktivität auf Social Media, erklären die beiden Wissenschaftler in ihrem Artikel. Sie unterscheiden hier zwischen einer aktiven und einer passiven Social-Media-Strategie. Mit einer passiven Social-Media-Strategie ist laut der Wissenschaftler nicht gemeint, dass die Kommunikatoren keine Social-Media-Kanäle haben – die Befragten haben aus verschiedenen Gründen nur keine Strategie entwickelt beziehungsweise verwenden diese Kanäle nicht strategisch in Krisenfällen. Kommunikatoren mit einer aktiven Social-Media-Strategie verwenden ihre Kanäle dagegen dafür, Informationen zu verbreiten und sie aus ihrem eigenen Blickwinkel zu schildern. Dies kann insbesondere dann interessant sein, wenn die Kommunikatoren die Journalisten als ihre Gegenspieler verstehen, weil sie so den Blickwinkel der Journalisten in Frage stellen können.
Die Moral von der Geschicht‘
Die Autoren sehen für die Praxis die Chance, dass Behörden und Unternehmen in öffentlicher Hand über ihre Social-Media-Kanäle in Krisenfällen einen eigenen, zweiten Blickwinkel anbieten können, bei denen sie unabhängig von den Journalisten sind. Wie oben bereits ausgeführt, lässt sich dies auch auf private Unternehmen übertragen. Besonders für Unternehmen, die Journalisten als Gegenspieler sehen, bietet dies eine Möglichkeit, in Krisensituationen zu reagieren und aktiv die öffentliche Wahrnehmung mitzugestalten. Damit dies auch wirklich funktioniert, müssen Kommunikatoren allerdings aktive Social-Media-Strategien für den Krisenfall entwickeln.
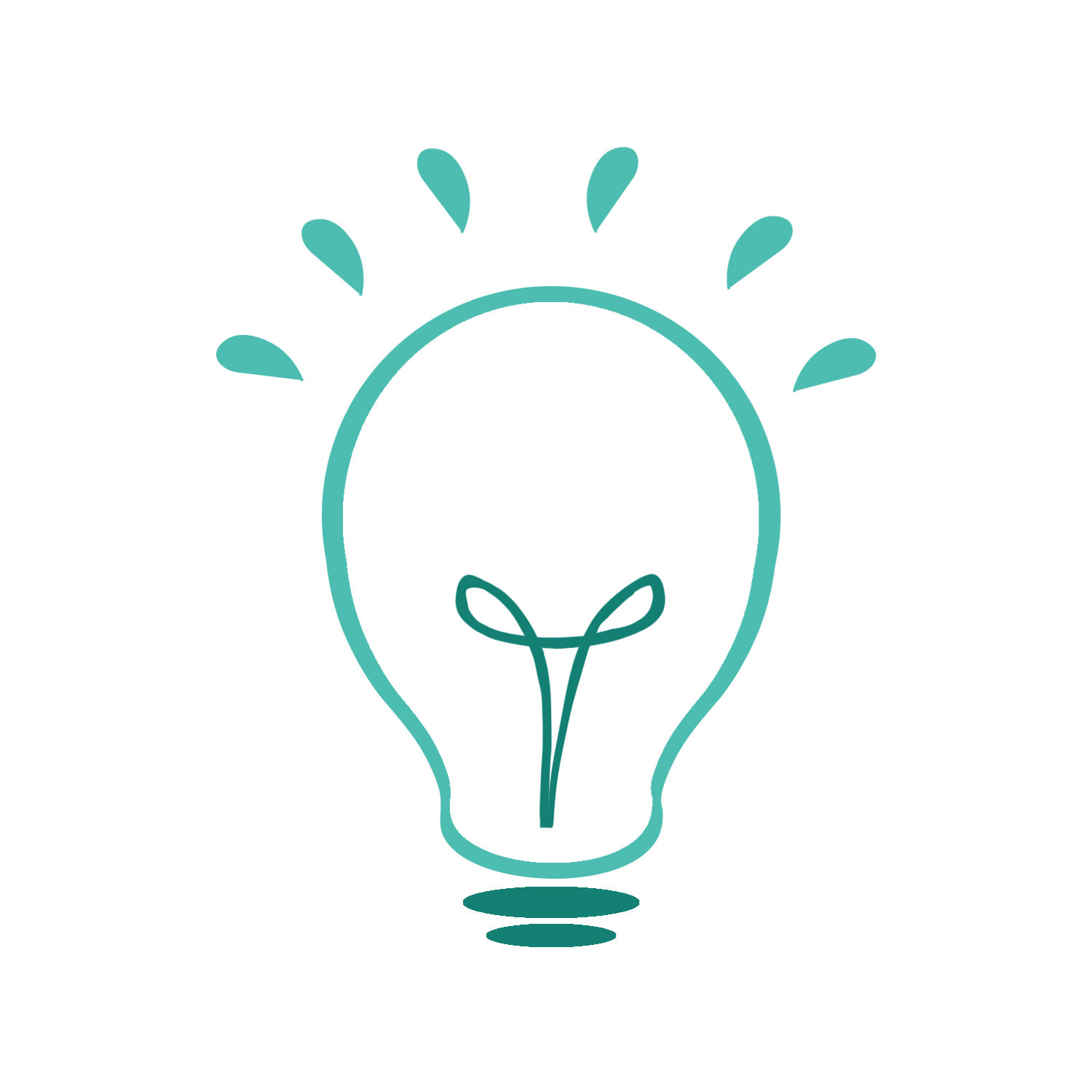 |
Key Facts
|
 |
Methode
|