Storytelling ist in aller Munde. Um den Erfolg von CSR-Projekten zu vermitteln, können reine Fakten aber besser geeignet sein.
Unternehmen sind heutzutage nicht mehr nur Anbieter von Produkten und Dienstleistungen. Stakeholder wollen Informationen über die soziale Verantwortung, die ein Unternehmen z.B. in den Bereichen Umweltschutz oder Mitarbeitermotivation übernimmt. Kurzum: Die Stakeholder wollen ein transparentes Unternehmen.
Die genannten Themen fallen in den Bereich der Corporate-Social-Responsibility (CSR). Die Kommunikation darüber ist ein Balanceakt. Zum einen müssen Unternehmen über CSR reden, um ihre Reputation zu halten oder zu verbessern. Zum anderen reagieren die Stakeholder aber mitunter skeptisch auf die CSR-Kommunikation. Hierbei spielt es eine Rolle, über wie viel Vorwissen die Stakeholder zum Thema bereits verfügen.
Das konnten zwei Wissenschaftler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur herausfinden, als sie die Kommunikation über die Erfolge von CSR-Projekten untersuchten. In der Studie verwendeten die Autoren das Beispiel einer fiktiven CSR-Kampagne im Gesundheitsbereich. Sie überprüften unter US-amerikanischen Bürgern, wie diese darauf reagieren, wenn sie ihnen die Erfolge der CSR-Projekte entweder als Human-Interest-Story, oder aber als faktenbetonten Bericht präsentierten.
Die Verpackung macht’s
Häufig heißt es, Storytelling sei der Königsweg in der PR, doch die Studie zeigt, dass dies differenzierter zu betrachten ist. Denn sowohl Storytelling als auch ein faktenbetonter Ansatz haben ihre Vor- und Nachteile bei der Ergebnisdarstellung von CSR-Projekten. Der grundlegende Zusammenhang scheint einfach: Stakeholder neigen eher dazu, Produkte von Unternehmen zu kaufen, dessen verfasste Artikel sie als unterhaltend empfinden.
Doch die Autoren fanden heraus, dass der Faktor Skepsis diesen Zusammenhang beeinflusst. Manche Menschen neigen dazu, Informationen zu hinterfragen und anzuzweifeln. In dieser Studie wurde diese Skepsis auf Informationen bezogen, die Unternehmen bereitstellen.
Es stellte sich heraus, dass Skepsis nur bei Storytelling eine Rolle spielt, nicht aber, wenn Stakeholder einen faktenbetonten Bericht lesen. Die skeptische Grundhaltung bewirkt, dass die positiven Emotionen, die eine Story im Idealfall auslöst, sich weniger stark in einer positiven Einstellung zum Unternehmen niederschlagen. Kurzum: Auf grundsätzlich skeptische Stakeholder haben Human-Interest-Stories über den Erfolg von CSR-Projekten einen weniger langfristigen Effekt.
Laut den Autoren ist es außerdem bedeutend, für wie wichtig die Stakeholder ein Thema für sich selbst einstufen. Wem ein Thema wichtig ist, der wird, zumindest beim Storytelling, auch mehr über die Argumente nachdenken – doch das ruft weniger starke Emotionen hervor.
Das Stakeholder-Interesse als Schlüssel
Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass Storytelling weniger effektiv ist, wenn es darum geht, die Erfolge von CSR-Projekten an interessierte Stakeholder zu vermitteln. Außerdem spielt die Skepsis gegenüber Informationen, die ein Unternehmen bereitstellt, ausschließlich beim Storytelling eine Rolle.
Laut der Wissenschaftler müssen Unternehmen bei ihrer CSR-Kommunikation also darauf achten, wie wichtig das Thema für die verschiedenen Zielgruppen ist. Für Stakeholder, die bereits viel Vorwissen haben, eignen sich faktenbasierte Ansätze, um den Erfolg der CSR-Projekte zu präsentieren. Für diejenigen, die kaum oder kein Vorwissen haben, bietet sich dagegen Storytelling an.
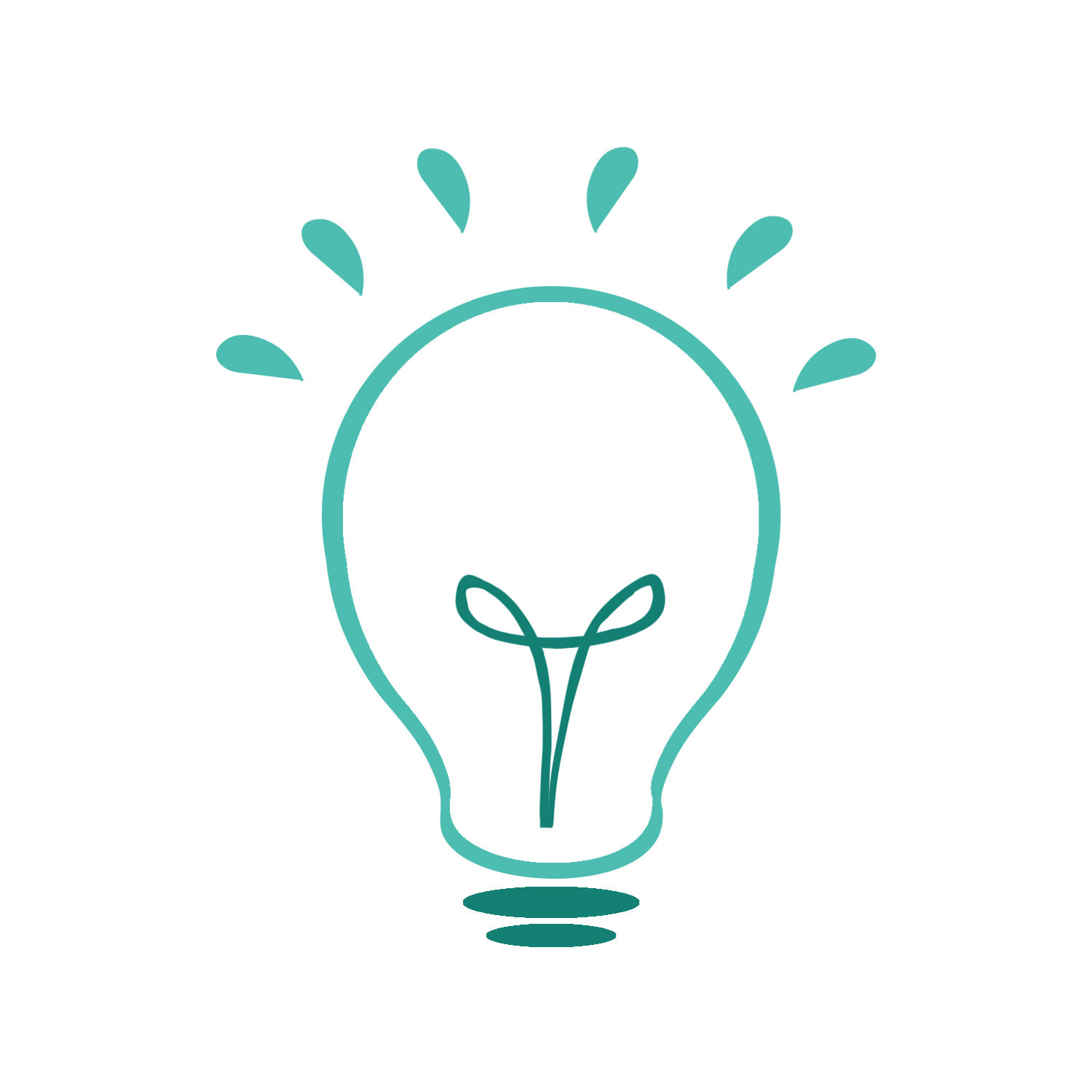 |
Key Facts
|
 |
Methode
|